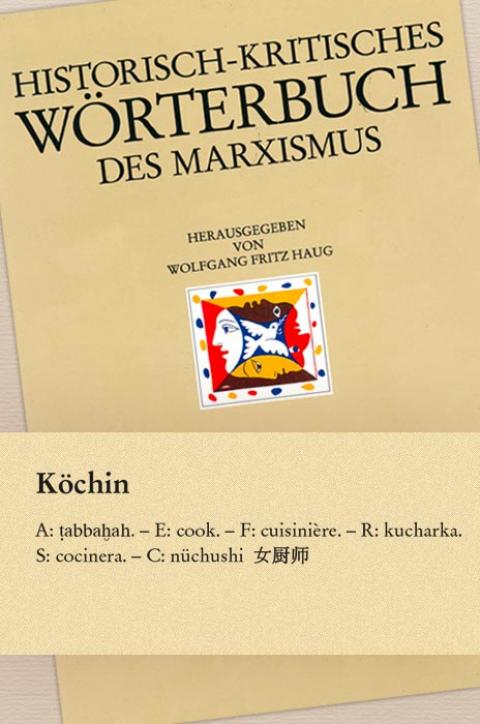
Der Lenin zugeschriebene Satz, die K solle den Staat regieren, schlägt eine emanzipatorische Schneise für Frauen und orientiert zugleich hin auf eine sozialistisch-demokratische Politik als Lernprojekt. Der Satz wurde vielfach aufgenommen, gedeutet, sogar in Gedichtform gebracht, schließlich metaphorisch genutzt als Buchtitel – Küche und Staat –, um Frauen zu ermutigen, sich politisch einzumischen, mit dem Ziel, »die gesellschaftlichen Verhältnisse so umzugestalten, dass alle Bereiche von allen herrschaftsfrei und also gemeinschaftlich geregelt werden können« (Haug/Hauser 1988, 7). Um jenes Diktum und seine Rezeption zwischen Staats-, Emanzipations- und Revolutionspolitik historisch-kritisch zu situieren, ist ein Exkurs in die Sozial- und Kulturgeschichte der K angebracht.
1. Begriffsvorkommen und Quellenlage. – In den üblichen Nachschlagewerken einschließlich des Katholischen Soziallexikons (1980) und des Evangelischen Staatslexikons (1987) gibt es den Begriff K nicht; selbst feministische Handbücher haben keinen solchen Eintrag: so kennen etwa Bonnie Anderson u. Judith P. Zinsser (1988, dt. 1993) weder K noch Küche noch Kochen. Im Lexikon von Barbara Walker zum Geheimen Wissen der Frauen (1983) gehört erstaunlicherweise das Kochen so wenig dazu wie die Küche, erst recht nicht die K, wohl aber »Königtum «. Annette Kuhn (1992) führt in ihrer Chronik der Frauen das Kochen und die Küche im Register, aber keine K. Jedoch befasst sie sich u.a. mit den Kochtätigkeiten der Frauen. Letzteren schreibt sie zu, dass »sie die Kochkunst entwickelten« (32), hitzebeständige Gefäße und schon 2000 v.Chr. in China »den Dampfdrucktopf« (56) erfanden. – Barbara Olsson untersucht die literarische Darstellung der Küche als »Eigenraum der Frau (und Fremdraum für den Mann)«, der die »weibliche kulturelle Identität als Nahrungsspenderin und Hausfrau« (2001, 134) sichere und gerade deshalb unweigerlich verlassen werden müsse (144).

 von
von  von
von  von
von  von
von