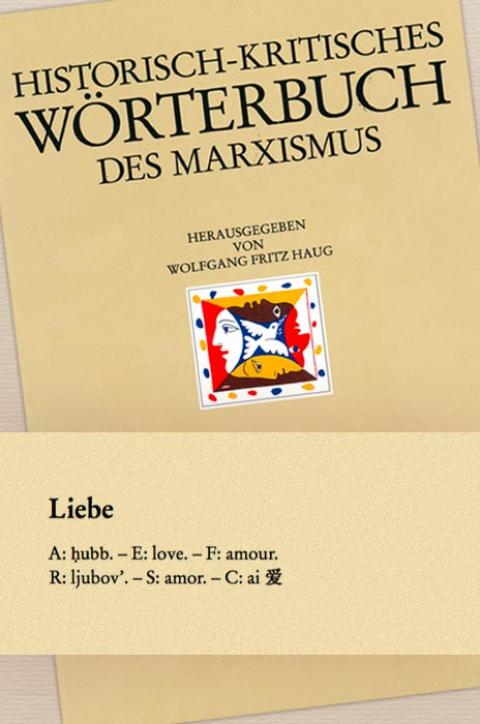
I. L als Hingezogensein zu jemand oder etwas Geliebtem mag auf den ersten Blick als grundpositiv erscheinen, eine Kraft, die Menschen verbindet, ein Glücksbringer. Der Gedanke stockt, wenn er auf die Dialektik der L stößt. Diese hebt die Verdinglichung auf, die ihr anderes Selbst, der Sex, begehrt. Wie dieser ist sie allgegenwärtig im Imaginären, in der Religion nicht weniger als in der Reklame. Sie ist bei der Ordnung und bei ihrer Subversion. Sie ist das Persönlichste, dem die unpersönlichen Institutionen – Staat, Kirche, Kapital – ihre Sprache entnehmen. Sie geht mit ihrem Gegenteil, dem Hass, schwanger und ist mit Leben und Tod geladen. Sie strebt ins Freie und verbindet sich mit Macht und Herrschaft. Entwaffnet sie hier die Gewalt, bedient sie sich ihrer dort. Sie ist die Hingabe, die der Ausbeutung anheimfällt. Sie kann einer Schutzhaft gleichen und ist zugleich das Verlangen, daraus zu entkommen. Sie rührt an den Sinn des Lebens und fungiert als Ersatz dafür. Dies alles hat zu allen Zeiten und in allen Kulturen die Menschen umgetrieben und ihre Mythen, Bildwerke und Lieder gefüllt.
Der abendländischen Überlieferung boten die mesopotamischen Hochkulturen Vorlagen, die über das babylonische Exil der Juden (598-539 v.u.Z.), das für ihre Identitätsbildung (im Doppelsinn von Bildung und Widerstand) wichtig war, in die Bibel eingeflossen sind. Die Dialektik von sinnlicher L, Kampf und Tod durchzieht das Epos von Gilgamesch, dem sagenumwobenen Stadtgründer und König der Sumerer vom ersten Viertel des 3. Jahrtausends v.u.Z., und dem zu seiner Vernichtung erschaffenen Menschentier Enkidu, der ihm an Stärke gleicht. Beider genitale Potenz wird besungen. Gilgamesch soll die jungen Frauen seiner Untertanen vor ihrer Verheiratung beschlafen haben und Enkidu durch einen sieben Tage währenden Liebestaumel mit einer Schamkat (einer Tempelprostituierten) in einen Menschen konvertiert worden sein. Ungeachtet dessen gehen Gilgamesch und Enkidu aus ihrem Kampf auf Leben und Tod als Liebhaber hervor.

 von
von  von
von  von
von  von
von